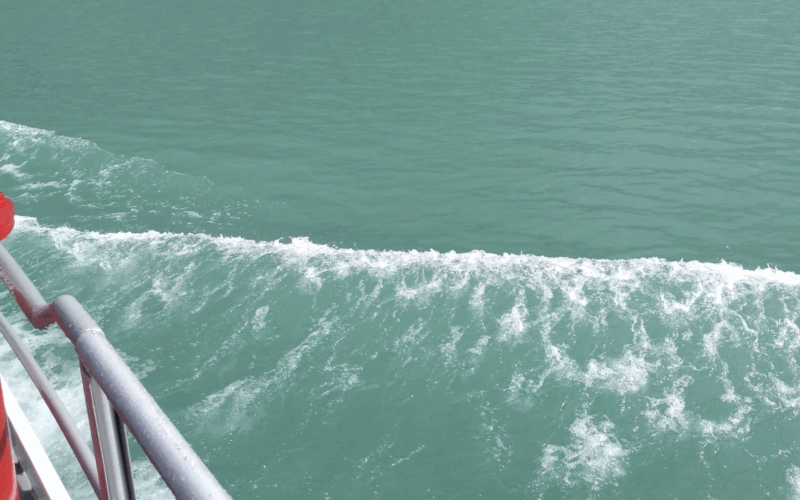Beate Heßler (Interviewerin) und Yagana Yousefi (Übersetzerin) haben die Interviews im Rahmen der karla Bürger:innen-Redaktion geführt. In Zusammenarbeit mit Sophie Tichonenko (Leitung Partizipation) wurden die Inhalte in einen journalistischen Text gegossen.
Chiman Gol: Von Kurdistan nach Konstanz
Chiman Gol (52 Jahre) wurde in Sanandadsch im kurdischen Teil des Irans geboren. Ein Ort, an dem traditionelle Geschlechterrollen das Leben der Frauen bestimmten. Schon als kleines Mädchen fiel es ihr auf, wie unterschiedlich Jungen und Mädchen behandelt wurden. In ihrer Familie jedoch war das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ausgeglichener. „Mein Vater war gebildet und behandelte uns Kinder unabhängig vom Geschlecht gleich“, erklärt sie. Diese Unterstützung in ihrer Familie war jedoch eine Ausnahme. „Ich wollte immer etwas tun, um denen zu helfen, die weniger privilegiert waren“.
Trotz der Herausforderungen kämpfte Chiman Gol für die Rechte von Frauen und Kindern. Sie gründete einen Verein, der sich für die Aufklärung über gesetzliche Rechte von Frauen und Kindern einsetzte, was in einem autoritären Regime riskant war. „Wir organisierten Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag, aber die Polizei bedrohte uns oft. Es war gefährlich, doch wir wussten, wie wichtig es war“, erinnert sie sich. Ihr Engagement für die Rechte von Frauen brachte sie in direkte Konfrontation mit der Regierung. Davon hat sie sich nicht einschüchtern lassen.

„Die Polizei überwachte uns ständig, aber wir haben nicht aufgegeben. Es war unsere Verantwortung, anderen zu helfen“, erzählt sie.
Der Umzug nach Deutschland im Jahr 2019 war ein Wendepunkt für Chiman Gol. „Ich kam ohne Wohnung, ohne Geld und ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland. Es war ein schwieriger Anfang“. Doch die Ankunft in Deutschland brachte auch eine neue Freiheit mit sich. „Zum ersten Mal konnte ich ohne Angst vor Verfolgung leben“, sagt sie. In Deutschland erlebte sie eine Freiheit, die ihr in ihrem Heimatland aufgrund ihrer Arbeit als Frauenrechtlerin und der ihres Mannes als Oppositionspolitiker immer wieder verwehrt geblieben war. Heute sieht sie ihre damalige Arbeit im Iran und die Verantwortung für Frauenrechte nicht nur als persönlichen Kampf, sondern als einen globalen Aufruf. „Ich hoffe, dass in Zukunft alle Menschen gleiche Rechte haben, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Religion“, so ihre Vision.
Sanandadsch, die Hauptstadt der kurdischen Provinz Kermanschah im Westen des Iran, ist ein Zentrum der kurdischen Kultur und des Widerstands. Die Kurd:innen im Iran, insbesondere Frauen, leben seit Jahrzehnten unter politischer und kultureller Unterdrückung.
Historisch gesehen wurden die Kurd:innen nach der Gründung der Islamischen Republik 1979 systematisch verfolgt. Die kurdische Sprache und Kultur wurden marginalisiert, und kurdische Aktivist:innen wurden verfolgt. Sanandadsch war in dieser Zeit ein Brennpunkt, besonders während des Iran-Irak-Kriegs, als kurdische Gebiete verstärkt militärisch unterdrückt wurden.
Für kurdische Frauen in Sanandadsch war die Situation besonders schwierig. Sie kämpften nicht nur gegen die staatliche Repression, sondern auch gegen patriarchale Strukturen innerhalb der eigenen Gemeinschaft. In vielen Fällen war es für sie nahezu unmöglich, ihre Rechte auf Bildung und Arbeit durchzusetzen. Frauenrechte waren stark eingeschränkt, und viele Frauen trugen die doppelte Last von ethnischer und geschlechtlicher Diskriminierung.
Auch heute noch kämpfen kurdische Frauen in Sanandadsch und anderen kurdischen Gebieten für ihre Rechte. Proteste und Widerstand gegen die politische Unterdrückung sind an der Tagesordnung, doch die Repression bleibt stark. Die aktuelle Bewegung für mehr Freiheit und Gleichberechtigung umfasst auch die Stimmen von kurdischen Frauen, die für ihre kulturelle Identität und ihre Rechte als Frauen eintreten.
Yagana Yousufi: Deutschland veränderte ihre Perspektive auf Gleichberechtigung
Yagana Yousufi (19 Jahre) lebte bis 2015 in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. Dort bekam sie mit, wie Mädchen und Jungen unterschiedlich behandelt wurden. „In meiner Familie gab es kaum Unterschiede zwischen meinem Bruder und mir, aber viele Mädchen wurden früh verheiratet. Besonders in weniger gebildeten Familien war die Diskriminierung spürbar“, sagt Yagana Yousufi. Sie erinnert sich an die enge Bindung zu ihren Schulfreundinnen und den Schmerz, als sie Afghanistan mit zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste: „Es war ein schwerer und emotionaler Moment, den ich nie vergessen werde.“ In Deutschland angekommen, war vieles neu für sie – insbesondere mit Blick auf das Thema Gleichberechtigung:
„Ich war schockiert, als ich erfuhr, dass Frauen hier in manchen Branchen weniger verdienen, besonders wenn sie Mütter sind“, berichtet sie.

So etwas hatte sie in einem Land, das sie als fortschrittlich und demokratisch wahrgenommen hatte, nicht erwartet. Heute arbeitet die Abiturientin im Einzelhandel und sucht nach einem passenden Studiengang für sich.
Yagana Yousufis Herz schlägt weiterhin für Afghanistan. Besonders nach der Machtübernahme der Taliban 2021 ist das Thema Frauenrechte für sie dringlicher denn je.
„Meine Tante verlor ihre Position, nur weil sie eine Frau ist. Das ist unvorstellbar“, sagt sie mit Nachdruck. Sie wünscht sich, dass Frauen in Afghanistan Zugang zu Bildung und Arbeitsmöglichkeiten erhalten, die ihnen aufgrund der politischen Situation und der kulturellen Normen derzeit verwehrt bleiben.
„Online-Kurse könnten ihnen helfen, sich weiterzubilden, auch wenn sie nicht zur Schule gehen können. Es ist an der Zeit, dass wir als globale Gemeinschaft zusammenarbeiten, um echte Veränderungen zu bewirken.“
Shakiba Noori: Sie war mit zehn Vollweise, floh nach Pakistan und wurde Religionslehrerin
Shakiba Noori (52 Jahre) erlebte schon früh einen tiefgreifenden Verlust. „Mit sieben starb mein Vater, drei Jahre später meine Mutter. Ich blieb mit meinen neun Geschwistern zurück“, erinnert sie sich. Das prägte ihren Lebensweg und stellte sie vor Herausforderungen, die sie als Mädchen besonders spürte.
„Wenn ich sagte, ich wolle Anwältin werden, hieß es immer: ‚Du bist ein Mädchen, wie willst du das schaffen?‘“.
In Pakistan fand sie nach ihrer Flucht dorthin eine neue Möglichkeit, sich einzubringen. „Ich nahm an einem Religionskurs teil und wurde Religionslehrerin“, erklärt sie. In dieser neuen Rolle konnte sie nicht nur ihr eigenes Leben verändern, sondern auch anderen helfen. „Ich unterrichtete Flüchtlinge aus Afghanistan und anderen Ländern. Das war eine Möglichkeit, etwas Positives zu bewirken“, sagt sie.

Im Jahr 2015 kam Shakiba Noori nach Deutschland und erlebte eine Freiheit, die sie so nicht kannte. „In Deutschland konnte ich ohne Angst leben und sogar spätabends noch alleine einkaufen gehen“, sagt Shakiba Noori, die in Konstanz ein neues Leben mit ihrer Familie aufgebaut hat. Inzwischen arbeitet sie in der Nachbarschaftshilfe und besucht weiterhin Deutschkurse. Sie betont die Gastfreundschaft und den Respekt, den sie erfahren hat: „Anders als andere, habe ich hier keine Diskriminierung erlebt. Die Menschen hier waren immer freundlich und respektvoll zu mir.“ Ihre Hoffnung für Afghanistan bleibt jedoch unerschütterlich: „Frauen sollten ihre Träume verwirklichen können, egal, wo sie herkommen.“
In den letzten Jahren haben sich die Rechte von Frauen in Afghanistan drastisch verschlechtert. Nach der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 wurden viele der Fortschritte, die Frauen in den letzten zwei Jahrzehnten erzielt hatten, rückgängig gemacht. Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule gehen, Frauen sind aus dem Berufsleben weitgehend ausgeschlossen und der Zugang zu Universitäten bleibt größtenteils verwehrt.
Die Taliban haben strenge Vorschriften eingeführt, die das öffentliche und private Leben von Frauen kontrollieren: Es herrschen restriktive Kleidungsvorschriften, und Frauen dürfen das Haus nur in Begleitung eines männlichen Vormundes verlassen. Diese Rückkehr zu strengen Geschlechterrollen hat das Leben von Millionen Frauen stark eingeschränkt. Trotz dieser Repression gibt es immer noch mutige Frauen, die sich heimlich weiterbilden, ihre Stimme in den sozialen Medien ergeben und sich so gegen das Regime auflehnen.
Ein Blick in die Zukunft
Die Ausschnitte aus den Geschichten von Chiman Gol, Yagana Yousufi und Shakiba Noori sind nicht nur ein Spiegelbild ihrer persönlichen Erlebnisse, sondern auch ein Symbol für den globalen Kampf um Frauenrechte und die Notwendigkeit von Solidarität. Jede von ihnen hat ihre eigene Reise durch das Leben gemacht – eine Reise, die sie von traditionellen Geschlechterrollen oder der Unterdrückung in ihren Heimatländern zu einem neuen Leben in Konstanz geführt hat.
Trotz der unterschiedlichen Hintergründe, Generationen und Erfahrungen teilen sie die Vision einer besseren Zukunft für Frauen: „Ich hoffe, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Religion“, sagt Chiman Gol. Yagana Yousufi betont die Bedeutung globaler Solidarität: „Es ist Zeit, als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um echte Veränderungen zu bewirken.“ Und Shakiba Noori erinnert im Gespräch daran: „Nach jeder dunklen Nacht kommt ein heller Tag.“

Die Veranstaltung „Drei Frauen – Drei Geschichten“, findet am 16. März von 15 bis 17 Uhr im Rahmen des internationalen Frauentags im Impulshäusle (Hofhalde 10a) in Konstanz statt. Sie den Besucher:innen die Gelegenheit, die Lebensgeschichten von Chiman Gol (Kurdistan, Iran), Yagana Yousufi (Afghanistan) und Shakiba Noori (Afghanistan) aus erster Hand erzählt zu bekommen.
Organisiert von Beate Heßler aus dem Projekt „DOUNIA“, wird die Veranstaltung kostenlos angeboten und bietet eine Plattform, um die Herausforderungen und den Mut dieser Frauen zu würdigen. In einer Zeit, in der die Rechte von Frauen weltweit zunehmend unter Druck geraten, sind ihre Geschichten ein Appell für mehr Gleichberechtigung und Solidarität – nicht nur in ihren Heimatländern, sondern auf der ganzen Welt und auch in Konstanz.
Das Projekt „DOUNIA“ richtet sich an Frauen mit Fluchthintergrund in Konstanz. Es greift durch wöchentliche Gruppenangebote im geschützten Mädchen- und Frauentreff und durch individuelle sozialpädagogische Beratung den besonderen Schutz- und Hilfebedarf von geflüchteten Frauen auf. Ziel ist dabei, die Frauen bei der Integration in das nähere soziale Umfeld zu begleiten.
Beate Heßler initiiert und begleitet das Gruppenangebot, wie z. B. kleine Deutschkurse, niederschwellige Treffangebote zu verschiedenen, bedarfsorientierten Themen, Freizeitangebote, (offenes Atelier oder Sportgruppen in den Anschlussunterbringungen), Teilnahme am internationalen Frauentag und der interkulturellen Woche und vieles mehr. Gabi Sehmsdorf übernimmt im gleichen Projekt die psychosoziale Einzelfallberatung.
Du willst mehr karla?
Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.
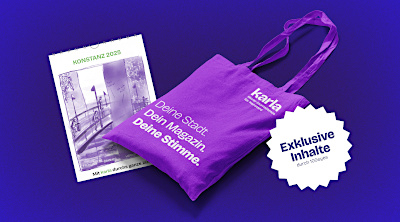
Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()