Lasst uns über Frauen und Mütter sprechen. Über jene, die es sich wünschen eine zu sein, jene, die sich genau das nicht wünschen, jene, die es sichtbar sind und jene, die es unsichtbar sind. Und über all die anderen Varianten des Mutterseins.1
- Die Produktion „Unter anderen Umständen“ des Stadttheaters Konstanz thematisiert Sterneneltern und Sternenkinder, basierend auf Interviews und wissenschaftlichen Studien.
- Sterneneltern, so nennt man Eltern, deren Kinder in der Schwangerschaft, während der Geburt oder kurz danach versterben.
- Die Inszenierung nutzt die antike Tragödie als dramaturgisches Modell und bettet individuelle Geschichten in einen kollektiven Erfahrungsrahmen.
- Unsichtbare Care-Arbeit, oft von Frauen geleistet, beeinflusst den Gender-Pay-Gap erheblich und bleibt gesellschaftlich wenig anerkannt.
- Väter sind in Diskussionen um frühe Elternschaft oft abwesend und ihre Perspektiven werden wenig repräsentiert.
- Das Gespräch betont die Notwendigkeit, unsichtbare Mutter- und Elternschaft sichtbar zu machen und gesellschaftliche Tabus zu brechen.
Es ist Montagabend, als ich mich in das Foyer des Stadttheaters begebe. Es sind bereits einige Menschen dort versammelt, sitzen in Grüppchen um die Tische herum, die sich vor dem Podium befinden. Dahinter versammelt sitzen fünf Frauen: Susanne Frieling (Regisseurin, Soziologin, Theaterwissenschaftlerin), Carola von Gradulewski (Dramaturgin) und Anna Eger (Schauspielerin), Sarah Seidel und Anna-Maria Post (Literaturwissenschaftlerinnen, Dozierende der Universität Konstanz) und Elisabeth Dittmann (Hebamme).
Sie und ihre Gäst:innen haben sich versammelt, um über das Thema Mutterschaft zu sprechen. Genauer: die unsichtbare Mutter- und Elternschaft. „Das Unsichtbare sichtbar machen“ ist einer der prägnantesten Sätze des Abends. Nacheinander werden neugierige Blicke in die verschiedenen Themen geworfen: die unsichtbare Mutterschaft konkret mit Blick auf eine aktuelle Inszenierung des Theaters und weiter gefasst, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und unsichtbare Care-Arbeit. Begleitet wird das Ganze von literarischen Texten, vorgetragen von Anna Eger, untermalt mit wissenschaftlichen Fakten und angereichert mit persönlichen Erfahrungen.
Das Gespräch ist eine Kooperationsveranstaltung des Stadttheaters mit der Uni Konstanz im Rahmen der Produktion „Unter anderen Umständen“. Unter anderen Umständen ist eine Stückentwicklung von Susanne Frieling und Florian Schaumberger, in der Sterneneltern und ihren Kindern eine Bühne geboten wird, um das Thema der unsichtbaren Mutter- und Elternschaft aus der stillen Ecke zu holen.
Sterneneltern, so nennt man Eltern, deren Kinder in der Schwangerschaft, während der Geburt oder kurz danach versterben. Ihre Kinder nennt man Sternenkinder. Nach dem Personenstandsgesetz werden Kinder als Totgeburt bezeichnet, die nach Erreichen der 24. Schwangerschaftswoche oder mit einem Gewicht von mindestens 500 Gramm geboren werden. Frühere Abbrüche und jene, die weniger als 500 Gramm wiegen, nennt man Fehlgeburt. Weltweit erleide laut einer Studie mehr als jede zehnte Frau mindestens einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt.

Vorerst widmet sich das Gespräch der Produktion „Unter anderen Umständen“. Die Regisseurin Susanne Frieling begegnete dem Thema erstmals privat, als eine Bekannte mit ihrer Erfahrung einer stillen Geburt an die Öffentlichkeit trat. Eine stille Geburt bezeichnet eine Geburt, bei der kein Schrei des Neugeborenen ertönt, weil es vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben ist.
Die private Unbeholfenheit, nicht zu wissen, wie man in dieser Situation umgehen sollte, brachte Frielings soziologische Ader zum Pochen.
„Da scheint es ein Leck zu geben, ein Tabu, das in die Ecke verbannt wird, weil es unbequem ist“,
sagt Regisseurin Susanne Frieling
Das Theater bietet die Möglichkeit, sich mit dem Thema zu befassen, ohne direkt damit konfrontiert zu werden, „quasi erstmal simulieren und sich dem Thema aus dem geschützten Dunkel des Raums annähern,“ so Frieling.
Eine antike Tragödie im Heute

Die Inszenierung beruht größtenteils auf Interviews mit betroffenen Eltern. Überschneidungen wurden einander gegenübergestellt und durch wissenschaftliche Studien und Zahlen sowie Blogeinträge ergänzt. Das dramaturgische Modell: die klassische antike Tragödie. Mit Antigone, Medea und Elektra tun sich Geschichten starker, weiblicher Figuren auf und die Frage, wie sich eine antike Tragödie im Heute abspielen könnte. Die Schablone der Tragödie schafft einen dramaturgischen Bogen, innerhalb dessen die Geschichten der Betroffenen stattfinden dürfen.
Der Begriff der Tragödie entstammt dem Theater der griechischen Antike. Auch Trauerspiel genannt, ist die Tragödie ein Drama, dessen Ende durch die Ausgangskonstellation schon festgelegt und unausweichlich ist. Die Heldenfigur findet sich in einer schicksalhaften Verstrickung und mit existentiellen Fragen konfrontiert. Der Ausgang der Heldengeschichte ist stets das Zugrundegehen an der unabwendbaren Schuld, die dem Protagonisten von den Göttern oder dem Schicksal auferlegt ist.
Über allem: das Schicksal. Das Hadern, die Wut, die Anklage und das Missverstanden-Werden. Als Übersetzungshilfe all dessen fungiert der antike Chor, der sich aus unterschiedlichen Frauen des Konstanzer Stadtensembles zusammensetzt. „Die Perspektive von Laien kann sehr bereichernd sein,“ so Frieling, „weil sie ganz andere Perspektiven und Lebensrealitäten mit anderen Bildern schaffen.“ Der Chor bettet in seiner Vielstimmigkeit die individuelle Geschichte eines Paares in einen kollektiven Erfahrungsrahmen. Die Erfahrung ist persönlich und subjektiv, aber kein Einzelfall.
Die unsichtbare Elternschaft sei ein wesentliches Thema, wenn man mit Betroffenen spreche. Auch auf räumlicher und ästhetischer Ebene zeigt sich die Auseinandersetzung damit auf der Bühne: ein Kubus, mit feinmaschigem Material bespannt, durchlässig und doch schützend, erinnert an einen Kokon. Immer wieder werden beobachtende Blicke dort hineingeworfen, während das Paar seine Geschichte erzählt, die eine Art Voyeurismus suggerieren. Ein Moment der Sichtbarkeit und des Wissens, der doch kollektiv beschwiegen wird.
Elisabeth Dittmann spricht aus der Innenperspektive als Hebamme, aus der es nur vollkommene Sichtbarkeit gebe. Das Bühnenbild, auch in ihrer Auffassung ein schützender Kokon, spiegelt wider, was sie in ihrer Arbeit erfährt: Ein Raum, innerhalb dessen gesellschaftliche Zwänge und Erwartungen ausgeschlossen sind, ein unschuldiger Raum, in dem es kein Richtig und kein Falsch gibt. Alles, was der Öffentlichkeit verborgen sei, sei für sie unübersehbar. Elisabeth Dittmann sagt:
„Ein Raum, in dem die Dinge einfach das sind, was sie sind.“
Elisabeth Dittmann, Hebamme

Unsichtbares Sorgen
An dieser Stelle wird eine weitere Thematik angeführt: Care-Arbeit. Laut Bundeszentrale für politische Bildung sind das „die Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns. Darunter fallen Kinderbetreuung oder Altenpflege, Arbeiten im Haushalt, Hilfe unter Freunden oder Ehrenamt.“ Bislang wurden diese Arbeiten überwiegend von Frauen geleistet und bleiben unsichtbar.
Sarah Seidel schildert die Ausmaße, die das Tragen sogenannter Sorgearbeit auf den Gender-Pay-Gap habe, der infolge dessen bei 46 Prozent liege und damit in keinem anderen europäischen Land so hoch sei wie in Deutschland. „Es scheint, und das wird meist von konservativen Kreisen so hervorgebracht, dass Frauen wie von Natur aus dafür geschaffen sind, Care-Arbeit zu leisten. Aber fürsorgliche Fähigkeiten und Verantwortungsbewusstsein sind nicht einfach da, sondern werden erlernt oder eben nicht,“ zitiert Seidel eine Studie von Almut Schnerring und Sascha Verlan zu Equal Care aus dem Jahr 2020.
Mütterliche Sorgearbeiten seien reproduktive Aufgaben, die in Deutschland eng mit der Vorstellung sozialer Mobilität verbunden seien. So gibt es wenige Länder, in denen der Bildungserfolg so sehr vom Elternhaus abhängt wie in Deutschland. Auch das sei eine schlechte Nachricht für Mütter, denn gerade sie trügen damit die Last, ob ein Kind später erfolgreich werde. Dieser Fakt würde häufig auf die Frage zurückgeführt, ob das Kind als Baby gestillt worden sei oder nicht, so Seidel.
„Und vielleicht übertreibe ich, aber vielleicht übertreibe ich auch nicht. Mütter sind also nicht nur von Natur aus dafür geschaffen, sich um Care-Arbeit zu kümmern, sondern auch von Natur aus für den Lebenserfolg ihrer Kinder verantwortlich. Ob Kinder also erfolgreich sind, liegt in den Händen oder an der Brust ihrer Mütter.“
Sarah Seidel, Literaturwissenschaftlerin und Dozentin an der Universität Konstanz
Wo sind die Väter?
Wir sprechen über die Last, die auf Frauen und Müttern wiegt, doch wo sind die Väter? Diese Frage stellt sich auch das Podium. Die Regisseurin Susanne Frieling erzählt, mit wie vielen Müttern sie in Vorarbeit sprechen konnte und mit wie vielen Vätern – mit einem. Jasper Diedrichsen, der die männliche Hauptrolle verkörpert und dem Gespräch als Zuhörer beiwohnt, berichtet vom Ringen darum, was seine Rolle sagen und wie viel Platz die Figur in der Erzählung einnehmen dürfe.
„Obwohl der Vater, den wir darstellen, im Trauerprozess gesetzt ist und [die beiden Figuren] auch als Paar da durch gehen, ist es selbst in der Form, in der wir es darstellen, noch indikativ dafür, wie abwesend und sprachlos die männliche Perspektive doch ist.“
Jasper Diedrichsen, Schauspieler am Theater Konstanz
Auch Elisabeth Dittrich meint, es sei ein Dilemma, das sie nach jahrelanger Hebammentätigkeit immer wieder erlebe, dass speziell frühe Elternschaft praktisch bei der Frau stattfinde. Frieling versucht diesen Unterschied soziologisch zu erörtern. So läge es womöglich an der Prozesshaftigkeit des Mutterwerdens, des Bewegens innerhalb eines Übergangsraumes, dessen Ergebnis nicht auf einen bestimmten Punkt gemünzt werden könne. Auch Dittmann meint, es könne mit körperlicher Erfahrbarkeit zu begründen sein und führt die Wichtigkeit einer natürlichen Geburt an.
Bei einem Tod des Kindes in der schon weiter fortgeschrittenen Schwangerschaft pochen Geburtshelfer:innen und Ärzt:innen meist auf eine natürliche Geburt. Der Vorgang der Geburt könne den Abschied erfahrbar machen, so Dittmann, denn die körperlichen Vorgänge seien eng mit den Seelischen verbunden. Diese Worte lassen einen Abschluss des Podiumsgesprächs finden, der wiederum das Gespräch zum Publikum hin öffnet.
- Anmerkung der Autorin: Wenn von Frauen und Mütter, Männern und Vätern gesprochen wird, sind alle Menschen mitgemeint, unabhängig vom biologischen Geschlecht oder gelesenen Gender. ↩︎
Du willst mehr karla?
Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.
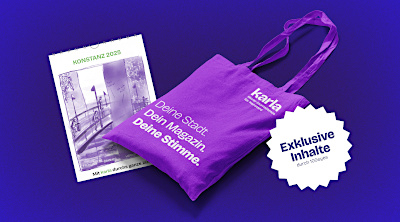
Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()




