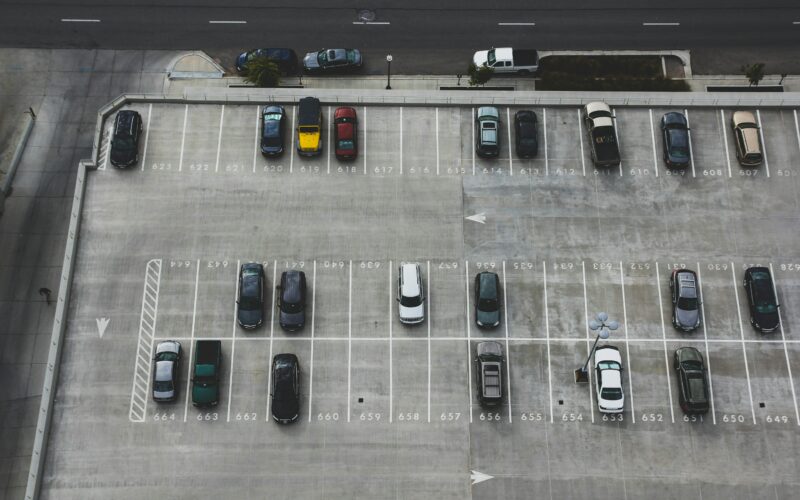Der menschengemachte Klimawandel ist real, viele Wissenschaftler:innen warnen seit Jahrzehnten vor den kommenden Herausforderungen. Und doch passiert immer noch viel zu wenig, obwohl uns die Konsequenzen der Erderwärmung in den vergangenen drei Jahren immer deutlicher bewusst geworden sind: viel zu heiße Sommer, ausgetrocknete Flüsse, Überschwemmungen, Waldbrände, Dürre, immer weniger Biodiversität und Artenvielfalt – die Liste ist lang. Gerade auch die Bodenseeregion und der Bodensee selbst sind Orte, die bereits jetzt schon und auch in Zukunft aufgrund des Klimawandels zu kämpfen haben werden.
Quaggamuscheln und Stacheliger Stichling als invasive Arten
Da sind zum einen besondere Stressfaktoren für den See, die durch die wechselnden Umweltbedingungen der letzten Jahrzehnte entstanden sind. Das Projekt Seewandel, bestehend aus Forschenden von sieben Institutionen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, hat in den vergangenen fünf Jahren das Ökosystem des Bodensees untersucht. Piet Spaak vom Schweizer Wasserforschungsinstitut Eawag hat es geleitet: „Wir haben untersucht, wie der See auf Veränderungen wie Nährstoffrückgang, invasive Arten und Klimawandel reagiert.“ Invasive Arten sind gebietsfremde Arten, die durch den Menschen – ob unbeabsichtigt oder beabsichtigt – eingeschleppt wurden, sich dort etablieren und damit vorhandene Ökosysteme nicht nur verändern, sondern auch gefährden können. Dabei haben sich besonders zwei Wasserorganismen hervorgetan: die Quaggamuscheln und der Stachelige Stichling.
Erstere konnten zu Beginn des Projekts vereinzelt nachgewiesen werden, mittlerweile besiedeln sie fast den ganzen See. „Da hatten wir Glück im Unglück, dass wir die Ausbreitung so gut mitverfolgen konnten, und wir denken, dass das noch viel schlimmer werden wird“, sagt Spaak. Das Problem mit den Quaggamuscheln: Die Muscheln pflanzen sich mit einer großen Geschwindigkeit fort und haben im Gegensatz zu anderen Muschelarten keine Probleme mit der Tiefe des Wassers. „Die finden wir bis zur tiefsten Stelle im See.“ Dadurch, dass sich die Quaggamuscheln fast überall ansiedeln können, verstopfen sie Ansaugrohre von Wassergewinnungsanlagen oder beschädigen Kühlgeräte wie beispielsweise an der Universität Konstanz. Noch dazu vernichten sie nach und nach die Algenflächen und damit die Futterquelle der Fische. Die Muscheln ernähren sich selbst auch von den Algen, die sie aus dem Wasser filtern, und tragen damit zu einem immer kleiner werdenden Fischbestand im Bodensee bei.

Der Stichling sei ebenfalls eine große Herausforderung für den Bodensee, erklärt Spaak. „Das ist eine eingeschleppte Art, die aber wahrscheinlich schon vor mehr als 100 Jahren eingeschleppt wurde. Den Grund dafür kennen wir nicht, aber dieser Fisch hat jetzt auch das offene Wasser in Unmengen besiedelt.“ Er mache mittlerweile fast zu 90 Prozent der Fischarten im Bodensee aus. „Ich denke aber nicht, dass der Stichling andere Arten vollständig verdrängen wird. Aber es wird weniger von anderen Fischarten geben“, fügt er hinzu. Mit den Bodenseefelchen konkurrieren die Stichlinge beispielsweise um Nahrung, sie fressen beide die gleichen Planktonarten. Daher habe der Stichling vermutlich dazu beigetragen, dass sich die Anzahl der Felchen reduziert habe. Im vergangenen Jahr haben die Berufsfischer laut der Internationalen Bodenseekonferenz für die Fischerei (IBKF) am gesamten Obersee nach vorläufigen Zahlen rund 20 Tonnen Felchen gefangen. In den Jahren 1995 bis 1999 lag der Durchschnitt noch bei 843 Tonnen pro Jahr.

Auch die durch den Klimawandel erhöhte Wassertemperatur habe laut Spaak zwei Auswirkungen auf den Bodensee:
„Die eine Seite ist, dass das Wasser wärmer ist und dass Organismen, die das wärmere Wasser lieben, einen Vorteil gegenüber den Organismen haben, die kaltes Wasser brauchen, wie zum Beispiel Felchen.“
Piet Spaak
Die zweite Herausforderung sei die immer seltener werdende Durchmischung des Wassers, wodurch immer weniger Sauerstoff in die tiefer gelegenen Stellen des Bodensees gelangt. „Das wird auf Dauer zu einem großen Problem.“
Spaak und sein Team arbeiten an der Genehmigung eines Nachfolgeprojekts, in dem sie mit Modellen simulieren wollen, was solche invasiven Arten für die Zukunft des Bodensees bedeuten werden.
„Um die Zukunft des Sees mache ich mir große Sorgen. Natürlich, die Quaggamuscheln machen das Wasser vielleicht klarer und man kann fast bis zu 20 Meter tief gucken. Das bedeutet aber auch, dass der See sehr nährstoffarm sein wird. Wahrscheinlich wird es immer weniger Fische geben und die Muscheln werden zusätzliche Probleme verursachen, wie Leitungen verstopfen, und teilweise müssten Anlagen neu gebaut werden“
, zählt er auf.
Zu hohe PFAS-Chemikalienkonzentration im Bodensee
Auch andere, vor allem menschengemachte Einwirkungen verändern das Ökosystem des Bodensees. Die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) hat eine zu hohe Konzentration von sogenannten PFAS-Chemikalien im Bodensee nachgewiesen. PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen und sind schädliche, langlebige Industriechemikalien. Laut IGKB sind dies synthetisch hergestellte und damit nicht natürlich vorkommende Stoffe, die man mittlerweile weltweit in der Umwelt finden kann. Sie können nur langsam abgebaut werden und damit oft lange existieren. Viele PFAS können sich zudem in Menschen und Tieren anreichern. Beispiele für langlebige PFAS-Chemikalien sind die Beschichtung von Pfannen, Imprägnierungsmittel, Zahnseide oder der Löschschaum von Feuerwehren.
In der Europäischen Union gibt es bestimmte Grenzwerte, die eine Konzentration von PFAS nicht überschreiten sollte. Im Bodensee und seinen Zuflüssen wurde ein bis zu achtmal erhöhter Wert als die EU-weit geltenden Grenzwerte gemessen. Die Konzentrationen lagen zwischen 0,001 und 0,005 Mikrogramm pro Liter. Auch in den Bodenseefelchen wurden teils deutlich zu hohe Werte nachgewiesen (zwischen 6 bis 23 Mikrogramm pro Kilogramm). Daher fordert die IGKB ein Verbot dieser Stoffe. Recherchen des NDR, WDR und der SZ im Februar haben in Deutschland auch besonders viel PFAS im Trinkwasser nachgewiesen, mit einem Wert von 20,3 Mikrogramm pro Liter. Der EU-Grenzwert liegt bei 0,1 Mikrogramm.
Menschengemachte Salinitätsveränderungen beschädigen das Ökosystem des Sees
Christian Voolstra, Professor für Genetische Adaptation in aquatischen Systemen an der Uni Konstanz, hat gemeinsam mit Till Röthig vom Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie eine Studie zu menschengemachten Salinitätsveränderungen, also Veränderungen des Salzgehalts von Gewässern, und deren Auswirkungen auf marine Organismen und Ökosysteme veröffentlicht. Der Klimawandel erhöht Regenfälle und die Verdunstung, das hat Auswirkungen auf stehende Gewässer und Küstenregionen. Diese Regionen sind größtenteils ökonomisch und ökologisch wichtig – für Menschen und auch die Fischerei. Der Klimawandel sei multifaktoriell, viele Studien würden sich nur die Temperaturerwärmung ansehen und dabei Salinitätsveränderungen, Ozeanansäuerung und gelöster Sauerstoff aufgrund der Erwärmung der Wassertemperatur außer Acht lassen. „Das ist eigentlich schon schlimm genug. Wenn dann noch die anderen Faktoren dazukommen, dann ist das meistens kein schöner Ausblick.“
Auch das Ökosystem des Bodensees ist an einen recht stabilen Salzgehalt gewöhnt. Die Salinität interagiert mit Temperatur oder Sauerstoffgehalt des Wassers. Neben den klimabedingten Veränderungen beeinträchtigen aber auch Landnutzung, Urbanisierung und Flussregulierung den Salzgehalt. „Mittlerweile ist es ja so, dass man nicht mehr Wissenschaftler sein muss, um die Änderungen zu sehen“, meint Voolstra. Auch am Bodensee würde man klar sehen, wie viel die Wasserqualität abgenommen habe. Je wärmer das Wasser werde, desto weiter würden bestimmte Tierarten abtauchen. „Die einfache Formel ist: Kaltes Wasser ist nährstoffreich und warmes Wasser ist nährstoffarm und sauerstoffarm.“ Dadurch fände auch weniger Sauerstoffaustausch mit der Oberfläche statt. „Das ist immer so ein Kreis von Dingen, die sich dann gegenseitig bewirken“, unterstreicht er.
Diese Veränderungen im Bodensee können auch auf die Organismen im See Auswirkungen haben. Es gebe die, die einen relativ breiten Salzgehalt abdecken können, und andere, die eine enge Toleranz aufweisen. „Generell wird höchstwahrscheinlich die Biodiversität runtergehen und das wird dann nicht zu Monokulturen führen, aber einige Arten, die das ganz gut abhaben können, werden dann wahrscheinlich dominant sein. Und dann bewahrheitet sich auch wieder diese große Weisheit, je weniger Arten man hat, desto weniger robust sind die Ökosysteme gegen äußere Störungen“, sagt Voolstra.
Für die Zukunft des Bodensees bedeutet das laut Voolstra Folgendes:
„Die Auswirkungen werden immer schlimmer, man kann im Prinzip Notpflaster aus der Tasche ziehen, um sich mehr Zeit zu kaufen, um diese drastischen Auswirkungen irgendwie zu verzögern. Und die Idee ist dann, dass durch diese Verzögerung hoffentlich die Politik und Industrie nachzieht und man dann näher an der CO2-Neutralität dran ist. Das ist auf jeden Fall ein Problem, dieses ‚business as usual‘. Wenn man so weitermacht wie jetzt und gar nichts tut, dann wird das auf jeden Fall zum Kollaps des Ökosystems führen, aber es ist nicht so, dass wir nichts tun können, das ist auch ganz wichtig zu sagen.“
Christian Voolstra
Für Voolstra gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu verhindern. Zum einen könne man Organismen resilienter machen, bestimmte Sachen unter Naturschutz stellen, Wiederaufforstung betreiben. Oder auch eine sogenannte Rehabilitation sei denkbar, bei der man Spezies im Bodensee wieder einführt, die bereits ausgestorben sind. Wenn äußere Faktoren nicht geändert würden, passiere jedoch das Gleiche nochmal – die Organismen würden wieder verschwinden. „Entweder muss man die äußeren Faktoren ändern oder eben diesen Arten etwas mit auf den Weg geben und da hat die Forschung relativ große Fortschritte gemacht.“ Viele Menschen seien etwas ängstlich, wenn es um den Eingriff in die Natur gehe. „Aber man muss sich eben vor Augen führen: Es gibt keine Natur mehr, die unangetastet vom Menschen ist“, sagt der Experte. „Selbst wenn man mir jetzt die beste Stelle am Bodensee zeigt, kann ich dort innerhalb von einem Tag zeigen, dass da wahrscheinlich menschliche Fäkalbakterien im Wasser sind.“
Laut Voolstra müsse man auf lokaler, nationaler und globaler Ebene besser zusammenarbeiten. „Eine Sache, die man in der Korallenriffforschung ganz klar sieht, ist, dass immer lokale, regionale und globale Faktoren zusammenkommen. Es ist gefährlich, wenn man sagt, dass das von oben kommen muss, das wird dann auch gerne als Ausrede genommen: ‚Das ist ja der Klimawandel, da kann man lokal gar nichts machen‘.“ Dass die Verbesserung der lokalen Bedingungen die Effekte des Klimawandels abschwächen würden, zeigen auch einige Publikationen. „Die Wasserqualität im Bodensee ist ja viel besser als vor 50 Jahren zum Beispiel. Das macht schon einen Riesenunterschied. Was wir aber besser in unseren Kopf kriegen müssen, ist dieses ‚Wie viel man nehmen kann, ohne der Natur zu schaden‘, das haben wir, glaube ich, noch nicht so gut rausgekriegt.“ Voolstra wird zukünftig an salztoleranten Organismen forschen, die gleichzeitig auch hitze- bzw. stresstolerant sind. „Das wäre dann auch wieder ein interessanter Ansatz, dass man schaut, ob die zum Beispiel auch toleranter gegenüber Klimaveränderungen sind.“
Ein Seepapier gegen Mikroplastik
Eine Organisation, die versucht, Kommunen und Gemeinden am Bodensee mehr für das Ökosystem des Bodensees zu sensibilisieren, ist die Bodenseestiftung in Radolfzell. Gemeinsam mit dem Global Nature Fund haben Dimitri Vedel und seine Kolleg:innen ein sogenanntes Seepapier entwickelt, mit dem sie stärker gegen Mikroplastik vorgehen möchten. Das Thema Mikroplastik sei nichts Neues, meint Vedel. Mikroplastik wurde schon vor zehn Jahren im Gardasee nachgewiesen. „Wir haben überlegt: Wie bekommen wir das zum einen an die Öffentlichkeit und wie bekommen wir das zum anderen so bearbeitet, dass etwas dagegen unternommen werden kann?“
„Wir schwimmen tatsächlich in irgendeinem Bereich, wo wir gar nicht wissen, wie hoch eigentlich gerade diese Belastung ist. Wir wissen auf den Bodensee bezogen nur, da ist Mikroplastik drin.“
Dimitri Vedel
Das Forschungsinstitut in Langenargen habe bei einer anderen Untersuchung auch im Verdauungstrakt der Bodenseefische Mikroplastik nachgewiesen – Anlass für den Global Nature Fund und die Bodenseestiftung, ein Seepapier zu entwickeln. „Die Situation ist hinlänglich bekannt und es bringt nichts, den Zeigefinger auf irgendjemanden zu richten und zu sagen: Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, um das zu verhindern.“ Die Forschungsergebnisse allein hätten für Maßnahmen keine Grundlage geschaffen, die Konzentration sei im Bodensee niedriger als in anderen Seen. „Deswegen war unser Ansatz zu sagen: Nein, wir müssen diese gute Situation, die wir am Bodensee haben, ummünzen zur Vorreiterrolle. Was kann zusätzlich getan werden, um verschiedene Gruppen innerhalb von einer Kommune – und die Kommune ist unser Hebel – zu erreichen? Damit diese Belastungen nicht mehr werden und auch aktiv Maßnahmen ergriffen werden können, um diesen Eintrag zu reduzieren.“
Das Seepapier solle eine Art Werkzeugkasten für die Kommunen sein, um mit vielen verschiedenen Möglichkeiten gegen Mikroplastik vorzugehen und ihnen Ideen an die Hand zu geben, wie sie weiter vorgehen können. Am Anfang hätten sie eine Selbstverpflichtung der Kommunen erzielen wollen. „Da haben wir ganz schnell leider erfahren müssen, dass wir mit dieser aus unserer Sicht eher minimalen Forderung zu dieser Selbstverpflichtung auch ein bisschen auf die Nase gefallen sind.“ Viele Kommunen hätten gesagt, das sei ein wichtiges Thema, aber sie würden nichts unterschreiben. Da habe es eine ganz große Ablehnung vor allem auf der deutschen Seite gegeben, erzählt Vedel. Daher habe die Bodenseestiftung das Papier zu einer Erklärung abgeschwächt, mit dem Wunsch, dass Kommunen das Problem anerkennen und bereit sind, etwas gegen Mikroplastik zu unternehmen. „Das funktioniert jetzt ein bisschen besser, aber noch nicht so, wie wir es uns erhofften. Auf der Schweizer Seite allerdings sehr gut, auf der deutschen Seite weniger.“
Warum also wehren sich insbesondere die deutschen Kommunen dagegen? Für Dimitri Vedel gibt es mehrere Gründe: „Ich denke, dass die Gemeinden sich nicht selbst eingestehen wollen, dass noch gar nicht so richtig wahnsinnig viel unternommen wird. Und da steckt eigentlich das Missverständnis drin, weil Kommunen können und machen teilweise ja auch schon sehr, sehr viel.“
Die Bodenseeregion sei ja eine Tourismusregion. Daher müsse man das klar benennen. „Es ist eine Daueraufgabe, deswegen muss es die Kommune machen. Die Kommune hat aus unserer Sicht die Daseinsvorsorgepflicht, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, damit diese Belastungen schon von Anfang an reduziert werden und Maßnahmen einfacher zu ergreifen sind.“ Das funktioniere, wenn es irgendwann mal darum gehe, dass Kläranlagen umgerüstet oder weiterentwickelt werden müssten. „Dann wird es unglaublich viel Geld kosten und das gilt es zu verhindern. Gleichzeitig muss einfach dieses Bewusstsein da sein, dass, wenn es einmal im Ökosystem drin ist, es nicht einfach mehr rausgeht. Das kann nicht der Wunsch sein“, bekräftigt Vedel.
Vedel und sein Team haben Fortbildungen zu Messmethoden von Mikroplastik in Kläranlagen angeboten. Dabei seien fünf Kläranlagenmeister aus der Schweiz und keiner aus Deutschland gekommen. Der Experte glaubt, dass das Interesse auf Schweizer Seite höher sei, weil die Attraktivität des Bodensees auf dieser Seite wesentlich niedriger ist. „Die Tourismuszahlen auf der deutschen Seite sind enorm hoch. Wenn so etwas öffentlich diskutiert werden würde, gibt es die Sorge, dass sich das auf die Tourismuszahlen auswirkt“, gibt Vedel zu bedenken. „Und das Zweite ist, es gibt einfach noch keine gesetzliche Vorlage, die sagt, pro Liter Wasser darf so und so viel Mikroplastik schwimmen. Und so lange es diese Verpflichtung, diese gesetzliche Vorgabe nicht gibt, warum sollte man dann proaktiv sein?“
Welche Maßnahmen können Kommunen nun konkret umsetzen, um eine Vorreiterrolle beim Kampf gegen Mikroplastik einzunehmen?
Vedel nennt die Stadt Konstanz als Beispiel. Diese habe vor zwei Wochen beschlossen, ihre Kunstrasenflächen auszutauschen. Gleichzeitig hätte die Bodenseestiftung den Kommunen angeboten, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen, wenn es darum gehe, die Bürger:innen zu adressieren. Bei der öffentlichen Verwaltung könne man künftig vermehrt auf Mehrwegangebote setzen, genauso wie bei der Organisation von Festen. Das fange schon beim Befestigen von Schildern an. „Wie werden die festgemacht? Meist mit Kabelbinder. Wie nimmt man sie ab? Sie werden abgezwickt und wo landen sie dann? Meistens auf dem Boden. Dass sich jemand die Mühe macht, das aufzuheben, ist eher selten der Fall.“ Auch in der Landwirtschaft könne man Erntefolien besser recyceln und auf Wochenmärkten verstärkt auf plastikfreie Verpackungen setzen.
Die Chancen für das Seepapier schätzt Dimitri Vedel dennoch gut ein. Sie seien gerade dabei, viele Umwelt- und Naturschutzverbände vor Ort für das Thema Mikroplastik stärker zu sensibilisieren. Auch würden einzelne Gemeinderät:innen in den Kommunen nochmal stärker darüber informiert, wie sie das Thema weiterführen könnten. „Das gelingt uns zum Beispiel ganz gut auf der Höri.“ Diese Verbände, zu denen Nabu, BUND, Naturfreunde und auch die Surf Rider am Bodensee gehören, würden dadurch noch verstärkt das Thema Mikroplastik in den Vordergrund stellen. „Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir über kurz oder lang Erfolg haben werden. Die Kommunen werden jetzt in den Klammergriff genommen.“
Du willst mehr karla?
Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.

Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()