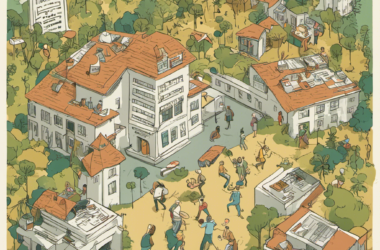Probleme löst man dann am besten, wenn sie noch nicht so groß sind, dass sie einem über den Kopf wachsen. Insofern wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, die Mängel im Übergang von Grundschule zu den weiterführenden Schulen zu beheben. Noch ist die Zahl der Betroffenen überschaubar, die Auswirkungen für die allermeisten verkraftbar und das Störpotenzial für das Gesamtsystem gering. Das wird sich ändern, je mehr Schüler:innen davon betroffen sind.
Und es werden in den nächsten Jahren mehr werden. Geburtenstarke Jahrgänge drängen an die weiterführenden Schulen. Die Zahl der Grundschüler:innen wird nach einer Prognose der Stadt Konstanz bis 2035 auf rund 3200 steigen. Das sind fast 700 Kinder mehr als in den jetzt schon überfüllten Konstanzer Schulen. Es ist absehbar, dass künftig viel mehr Kinder von Schulen abgewiesen werden, als dies im Moment der Fall ist.
Populäre Schulen vs. „Resterampe“?
Schon deshalb sollten wir jetzt genauer hinschauen. Aber nicht nur aus empirischen Gründen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen: Wollen wir wirklich so mit unseren Kindern umgehen? In dem wir sie an einem wichtigen Schritt ihrer Bildungslaufbahn mit Ablehnung konfrontieren? Und schaffen wir damit nicht ein System aus wenigen beliebten Schulen und einer großen, überspitzt gesagt, „Resterampe“?
Der Blick darauf lohnt aber auch deshalb, weil das Verfahren zur Lenkung von Schüler:innen wie in einem Brennglas drei sehr drängende strukturelle Probleme unseres Bildungssystems zeigt. Erstens: Das System reproduziert Bildungsgungerechtigkeit anstatt ihr entgegenzuwirken. Zweitens: Familien werden in der Politik erst dann gehört, wenn sie sich lautstark zu Wort melden. Drittens: Die individuellen Bedürfnisse der Kinder spielen im Zweifel immer eine untergeordnete Rolle. Aber der Reihe nach.
In Köln werden Schulplätze öffentlich verlost
Schauen wir als erstes auf die Bildungsungerechtigkeit: Die Auswüchse davon sind bundesweit zu beobachten. In Schleswig-Holstein melden Eltern ihre Kinder unter der Adresse von Hamburger Freunden, um sie an eine bessere Schule schicken zu können. Hamburger Privatschulen erkennen das bereits als Geschäftsmodell – sie bekommen mehr Geld für Kinder aus dem Umland. In Berlin halten einzelne Schulen Plätze in Jahrgängen frei für Kinder, deren Eltern sie einklagen könnten, in Köln hingegen werden Schulplätze teilweise öffentlich verlost, damit gar niemand erst klagen kann. Und in Konstanz?
Gibt es ein halbdurchsichtiges Verfahren, von dem Außenstehende nicht so genau wissen, wie es eigentlich funktioniert. Die nachgelagerten Gespräche zwischen Schulleitung und Eltern haben den Hauch von Nachverhandlungen, in denen jene Eltern, die besonders vehement argumentieren, vielleicht doch noch ihren Wunschplatz ergattern.
Wenn der Traum von der Wunschschule platzt
Zugang zu Bildung hängt zu oft vom sozialen Status ab
Das zeigt: Solche Schüler:innenlenkungsverfahren bevorzugen tendenziell Menschen höherer Einkommens- und Bildungsniveaus. Weil genau die wissen, wie man sich gegen bestimmte Entscheidungen auch zur Wehr setzen kann. Und sie sich die Zeit nehmen können, für ihre Sprösslinge zu streiten. Alle anderen, die entweder gar nicht mitbekommen haben, dass es solche „Nachverhandlungen“ gibt, die zu zurückhaltend sind, um gegenüber Schulleitungen offensiv zu argumentieren oder aus sprachlichen Gründen vielleicht gar nicht in der Lage dazu sind, die schauen in die Röhre.
Um es pointiert zu formulieren: Ein Journalist oder eine Architektin können spontan und kurzfristig einen halben Tag frei machen für die Schulsuche. Schichtarbeiter:innen oder Pflegepersonal können das eher nicht. Das ist ungerecht, weil es die Zugänge zu Bildungsangeboten am Ende eben doch wieder abhängig macht von Einkommen und Status. Kein Wunder, dass in kaum einem anderen Land der Bildungserfolg so stark vom sozialen Status abhängt wie in Deutschland.
Politik hört erst zu, wenn es laut wird
Das zweite Problem hängt mit dem ersten eng zusammen: Familien werden in der Politik erst dann gehört, wenn sie laut werden und im Zweifel klagen. Das zeigen nicht nur die Nachverhandlungen in den Schüler:innenlenkungen, sondern auch ein Beispiel aus dem frühkindlichen Bildungsbereich. Erst seitdem Eltern zunehmend auf einen Kitaplatz klagen, rückt das Problem der Kitakrise zunehmend in den Fokus. Was bislang als Privatsache galt, wird plötzlich zur Herausforderung für die Kommunen. Die rechtlichen Auseinandersetzungen dort haben die Veränderungsbereitschaft in den Ämtern geschärft.
Schon alleine deshalb, weil es finanzielle Auswirkungen für die Stadtkasse hat, wenn die Stadt nun wegen des Mangels hier und des geltenden Rechtsansoruchs auch die viel teureren Kitaplätze in der Schweiz bezahlen muss. Für 2024 kalkulierte die Stadt Konstanz dafür übrigens mit Kosten in Höhe von 360.000 Euro. Was wir daraus lernen? Wenn es ums Geld geht, bewegt sich was. Dabei müsste Veränderung viel grundsätzlicher anfangen. Zum Beispiel so: Familienpolitik muss endlich raus aus der „Gedöns“-Schublade!
Familienpolitik muss raus aus der „Gedöns“-Schublade!
Und damit sind wir beim dritten verheerenden Mangel des Systems: Die Bedürfnisse der einzelnen Kinder spielen kaum eine Rolle bei den Entscheidungen. Wenn Gruppen von Kindern einer Grundschule pauschal abgelehnt werden, dann berücksichtigt das keine individuellen Talente und Fähigkeiten.
Klar kann man sagen, für die Schulen ist das der rechtssichere und pragmatischere Weg. Aber ganz ehrlich: Sind das die angemessenen Adjektive für den Umgang mit unseren Kindern? Rechtssicher und pragmatisch? Klingt fast so, als würden wir beliebige Waren von A nach B verladen. Das müssen wir besser und einfühlsamer hinkriegen.
Die Verantwortung der Stadt
Die Schulen selbst haben an der Lage die geringste Schuld. Sie müssen unter den Bedingungen arbeiten, die sie vorfinden. Der Rahmen dafür wird von der Politik gesetzt. Und die hat auf verschiedenen Ebenen in den vergangenen Jahrzehnten nicht geliefert, was Familien brauchen. Der Schulträger, also die Stadt Konstanz, hat zu lange notwendige Sanierungen an den Schulbauten aufgeschoben. Auch in den wirtschaftlich besseren Zeiten wurde zu wenig in die Konstanzer Schulen investiert. Nun sind sie in vielen Teilen marode.
Mit dem jüngst beschlossenen Sparhaushalt wird das zum Dauerzustand – der Schulbau steht de facto bis 2035 still. Die einzige Ausnahme: der Neubau einer Grundschule sowie einer Verbundschule aus Gymnasium und Gemeinschaftsschule im neu geplanten Wohngebiet Hafner in Wollmatingen.
Was Land und Bund zur Krise beigetragen haben
Aber auch das Land Baden-Württemberg hat mit seiner sprunghaften Bildungspolitik (Stichwort: Hin und Her zwischen dem acht- und neunjährigen Gymnasium) zum Systemabsturz beigetragen. Bund und Land haben zudem die Kommunen zu oft mit neuen Gesetzen und Vorhaben allein gelassen.
Um nur ein Beispiel zu nennen: der ab 2026 anwachsende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Hier wie auch bei der Rückkehr zum G9 braucht es eigentlich neue Räume. Räume, die die Kommune aber nicht finanzieren kann, weil das Geld fehlt. Es ist ein ziemlicher Teufelskreis, in dem die Schüler:innenlenkungen nur ein Stein eines tristen Mosaiks der Ungerechtigkeiten ist.
Werden Jungs in der Schule benachteiligt?
Wie man es besser machen könnte
Trotzdem könnte man hier mal anfangen mit Verbesserungen: Mehr Transparenz im Verfahren, bessere und verständlichere Kommunikation gegenüber Familien, den leichten Marktgeruch in den Nachgesprächen mit Schulleitungen vermeiden.
Hilfreich könnte auch sein, die Ablehnungsbescheide nicht nur per Post, sondern zusätzlich per Mail zu versenden, damit wirklich alle betroffenen Familien zeitgleich informiert sind und kein Windhundrennen auf die verbliebenen Plätze entsteht. In anderen Bundesländern können Eltern auch zwei Wunschschulen bei der Anmeldung angeben. Auf diese Weise könnte man bei den Schullenkungen auch die Wünsche von Familien berücksichtigen.
Zeit, dass sich was ändert
So oder so: Jetzt wäre eine gute Zeit, das Problem anzupacken. Denn: Die Zahl der Betroffenen wird mit der Zahl der Schüler:innen steigen. Und vielleicht können wir uns ja zumindest darauf einigen: Je weniger Kinder man enttäuschen muss, umso besser.
Transparenz-Hinweis: Unser Autor war auch betroffen von der Schüler:innenlenkung in diesem Jahr. Inzwischen ist er aber froh, dass er einen guten Schulplatz für seinen Sohn gefunden hat.
Schule in Baden-Württemberg: Es ist kompliziert…
Du willst mehr karla?
Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.
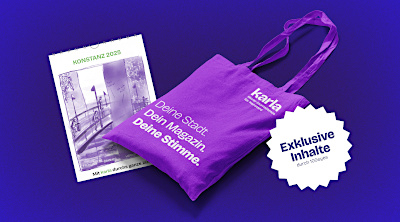
Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()