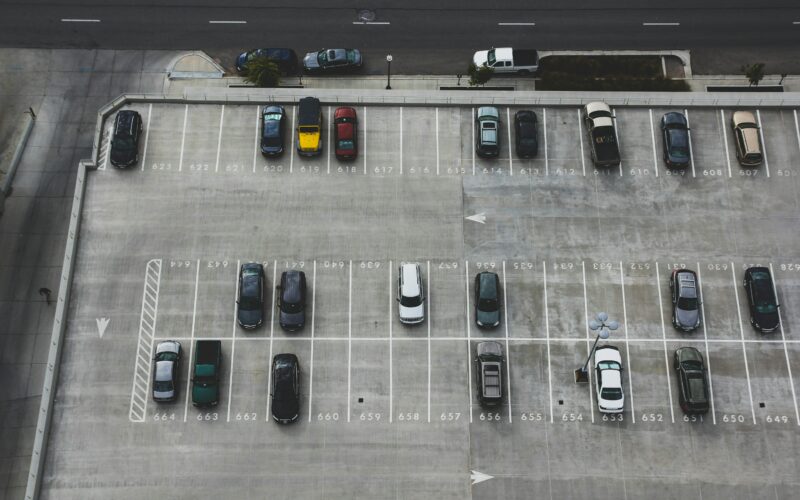Ein Essay von
Es ist November 2022. Ich sitze mit einer Tasse Tee und einem Stück Kuchen in einem Café und frage mich, inwiefern sich unsere Gesellschaft in einer Krise befindet. Krise, was heißt das eigentlich? Der Begriff taucht in jüngster Zeit an allen Ecken auf und vielleicht ist allein das schon der Beleg dafür, dass wir uns in einer Krise befinden: Wir spüren es.
Die Krise
Dem Philosophen Antonio Gramsci zufolge besteht die Krise in der Tatsache, „dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann“. In dem Sinne ist eine Krise ein Moment, in dem wir uns keinen Ausweg vorstellen können. Wir wissen, dass wir nicht weitermachen können, wie gehabt, ohne unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören, wissen aber nicht, wie eine Abkehr von der schleichenden Selbstzerstörung tatsächlich gelingen kann.
Aus dieser Perspektive betrachtet, befindet sich unsere Gesellschaft definitiv in einer Krise. Wir kennen Antworten auf die aktuelle Energiekrise, die übergeordnete Klimakrise oder auch die sich zuspitzende Krise der ungleichen Vermögensverteilung. Aber es scheint so, als will es uns einfach nicht gelingen, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Hitzewellen, Fluten, Corona, die Energiekrise – auch wenn wir hier überwiegend ein sehr wohlbehütetes Leben führen dürfen, spüren wir die Auswirkungen der sich überlagernden Krisen immer deutlicher im eigenen Leben vor Ort. Vielleicht gelingt es einigen von uns, sich vorzustellen, wie ein Leben aussehen könnte, in welchem wir uns nicht fortlaufend selbst ausbeuten. Aber welcher Weg dorthin führt, ist in unserer komplexen Welt der globalisierten Moderne kaum auszumachen.
Woran können wir uns festhalten, wenn alles in Bewegung ist?
Allzu verwunderlich ist das nicht. Das Weltgeschehen ist mit mehr Vernetzungen nicht nur komplexer geworden, es hat dabei auch an Geschwindigkeit gewonnen, sodass einem schwindelig wird. Mal ehrlich, wer kann denn bei dem, was alles gleichzeitig geschieht, noch den Überblick behalten? Und woran können wir uns festhalten, wenn immer alles in Bewegung ist? Es ist auch das, was unsere Zeit zu einer Krisenzeit macht: Wir fühlen uns vom Leben der Moderne überfordert. Ständig verändert sich alles. Das eine verschwindet, das andere taucht auf − und dazwischen immer wieder die Momente der Krise, in welchen die Ungewissheit herrscht.
Vielleicht müssen wir uns eingestehen, dass wir eben keinen Überblick haben und überfordert sind. Und vielleicht ermöglichen uns solche Eingeständnisse, dass wir damit beginnen, alte – für aktuelle Krisen verantwortliche – Gewohnheiten loszulassen und uns auf die Ungewissheit einzulassen. Denn, wenn wir den Weg nicht kennen, dann müssen wir ausprobieren.

Foto: Sophie Tichonenko
Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir die ganze Menschheitsgeschichte wie eine riesige Sammlung kleiner und großer Krisen vor. Weit rauszuzoomen und die Welt in geologischen Zeitabschnitten zu betrachten, hilft mir dabei, meinen Optimismus aufrechtzuhalten. Das klingt dann so: Dinosaurier waren etwa 170 Millionen Jahre lang die vorherrschenden Landlebewesen auf diesem Planeten. Selbst wenn ich die Menschheitsgeschichte großzügig auf 100.000 Jahre anlege, erstreckt sich die Ära der Dinosaurier auf ein 1700-Faches. Die Idee, die Geschichte der Menschheit nach all dem, was bis hierhin schon passiert ist, 1700-mal weiterzuspinnen, eröffnet mir ein ungemein beruhigendes Gefühl. Ein Gefühl, dass der Horizont mit unvorstellbar vielen Möglichkeiten für Entwicklungen und Wandel bestückt ist.
Nur, wer glaubt denn heute wirklich daran, dass die Menschheit sich bis dahin nicht längst selbst zerstört hat? Tatsächlich scheint die Lage der Welt mitunter so aussichtslos, dass im Gespräch mit älteren Mitmenschen öfter mal ein Satz fällt, der in etwa so klingt: „Ein Glück, dass ich all das, was da kommt, nicht mehr miterleben muss.“ Hinter dieser Perspektive steckt, wie ich finde, kein Pessimismus, sondern eine wichtige Erkenntnis: Der Ausblick auf eine bessere Welt führt nur durch Krisen.
Seit Jahrhunderten hat sich die Menschheit an einem Fortschritt hin zu mehr Wohlstand und Luxus orientiert. Zu glauben, dass wir an dieser Entwicklung festhalten können, lässt uns vielleicht in 300 Jahren mit einem aus der Kryostase aufgetauten Elon Musk den Mars besiedeln, aber die ökologische Krise auf der Erde nicht verhindern. Die Vorstellung, dass wir es schaffen, auf globaler Ebene das Narrativ von grenzenlosem Wachstum, Wohlstand und Konkurrenz in eine neu erzählte Geschichte von Genügsamkeit (Stichwort Suffizienz) und Kooperation umzuwandeln, ohne dabei durch Krisen gehen zu müssen, ist unrealistisch.
Ein Narrativ ist eine übergeordnete Erzählung, welche das Leben vieler Menschen prägt, indem sich Entscheidungen, Meinungen und Perspektiven an der Bedeutung des Narrativs orientieren. Ein anschauliches Beispiel eines großen Narrativs ist der sogenannte „American Dream“: Du kannst im Leben alles erreichen, wenn du dich nur genug anstrengst und richtig fleißig bist – vom Tellerwäscher zum Millionär. Das Narrativ des American Dream erzählt eine Geschichte, die sich zum Beispiel auch im Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“ wiederfinden lässt. Ein „Gegennarrativ“ erzählt zum Beispiel, dass das System (Familie, Wohnort), in welches wir geboren werden, ausschlaggebend für unseren Lebensverlauf ist und wir uns eben nicht unser Glück und Wohlstand selbst schmieden können. Narrative überlagern sich, sind räumlich nicht klar abgrenzbar und dementsprechend sind ihre Auswirkungen auf unsere Weltbilder komplex und nur schwer klar zu benennen.
Eine Frage, die sich mir in Hinblick auf Narrative immer wieder stellt: Welche Geschichte wird dir von der Welt erzählt und welche Geschichte erzählst du selbst?
Die Krise ist eine Notwendigkeit. Eine Situation, in welcher sich eine Not derart zuspitzt, dass eine Wendung beziehungsweise ein Wandel unabdingbar ist, wenn eine Katastrophe verhindert werden soll. Diese Wendung beinhaltet die Trennung von dem „Weiter-wie-bisher“. Denn das bedeutet der Begriff der Krise in seiner Wortherkunft: eine entscheidende Wendung, in welcher eine Trennung stattfindet.
Trennungen sind Teil unser aller Leben. Sie lassen uns spüren, dass wir wertvolle Verbindungen eingegangen sind, wenn sie wegbrechen. Sie demonstrieren die unausweichliche Erkenntnis, dass das Leben vergänglich ist. Und nicht nur das Leben, sondern auch all die von Menschen entwickelten Ideen und aufgebauten Systeme. Trennungen sind gerade dann schmerzhaft und besonders herausfordernd, wenn etwas verschwindet, was uns für das eigene Leben Orientierung und Halt gegeben hat. Sich im Leben neu zu orientieren, beinhaltet genau den Krisenmoment, welcher oben anhand von Antonio Gramsci beschrieben wurde: Etwas Altes stirbt und das Neue kann noch nicht geboren werden – es ist diese Orientierungslosigkeit, die eine Krise ausmacht.
Die Not
Eine Notsituation ist erst dann eine Notsituation, wenn wir sie wahrnehmen. Deswegen konnte die Gesellschaft so schnell und umfangreich auf die Corona-Pandemie reagieren. Menschen aus dem persönlichen Umkreis, die erkrankten, haben uns die Not direkt spüren lassen. Ich möchte an dieser Stelle allerdings ein größeres, übergeordnetes Bild der Not skizzieren, in welcher wir uns befinden. Ein Bild, das unsere Aufmerksamkeit nicht durch plötzliche Einschnitte erlangt. Es ist das eingangs erwähnte Bild des schleichenden Prozesses der Vernichtung unserer eigenen Lebensgrundlage: das Artensterben.

Foto: Moritz Schneider
In der Erdgeschichte gab es fünf große Massensterben, bei welchen aufgrund drastischer Veränderungen der Lebensbedingungen 70 bis 90 Prozent der Arten ausgelöscht wurden. Aktuell befinden wir uns inmitten des sechsten großen Massensterbens – oder inmitten des ersten „Vernichtungs-Events“, denn dieses Mal ist die Menschheit für das Artensterben verantwortlich. Eine viel diskutierte Studie aus dem Jahr 2017 belegte einen Verlust der Biomasse von Insekten von über 75 Prozent in weniger als 30 Jahren – schier unvorstellbare Zahlen. Eindrücklich ist dabei auch, dass die Studie in deutschen Naturschutzgebieten durchgeführt wurde und nicht etwa in städtischen Ballungsgebieten oder auf intensiv genutzten Agrarflächen. Insekten sind essenzieller Grundbaustein für Ökosysteme über Wasser. Das heißt, ohne sie können Ökosysteme, die Basis unserer Nahrungsversorgung, nicht funktionieren. Das macht das Artensterben schon jetzt zu einer Bedrohung für unsere zukünftige Nahrungssicherheit.
„Wir befinden uns in einer Krise seitdem unsere Lebensweise unsere Lebensgrundlage zerstört.“
Aus dieser Perspektive betrachtet befinden wir uns nicht erst seit Corona in einer Krise. Oder seitdem das Bewusstsein für den menschengemachten Klimawandel steigt. Sondern seitdem unsere Lebensweise unsere eigene Lebensgrundlage zerstört. Nur, wir haben es einfach viel zu lange nicht gemerkt. 1962, vor 60 Jahren, schrieb die Biologin Rachel Carson ein Buch mit dem Titel „Silent Spring“, in welchem sie Insektensterben und damit einhergehendes Vogelsterben am Einsatz chemischer Pestizide festmacht. Das Buch gilt als zentraler Auslöser für amerikanische Umweltbewegungen bis hin zur Gründung der amerikanischen Umweltschutzbehörde. Zehn Jahre später 1972, vor 50 Jahren, wurde das berühmte Buch „The Limits to Growth“ publiziert. Aber die Chance, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine entsprechende Wende einzuleiten, wurde verpasst.
Das Problem im Hier und Jetzt ist: Wenn wir die Gefahr des Artensterbens erst auf kollektiver Ebene erkennen, wenn wir sie direkt am eigenen Leib spüren, ist es zu spät, um eine Wende einzuleiten. Das Rad der Zeit natürlicher Ökosysteme ist ungemein größer und dreht sich um ein Vielfaches langsamer, als wir es von unserem beschleunigten Alltag der Gesellschaft gewohnt sind. Der Verlust unserer Lebensgrundlage vollzieht sich schleichend. Und diese Erkenntnis bringt uns zu dem, was es braucht, um eine Katastrophe – in diesem Fall das Aussterben unserer Art, das Aussterben des Menschen – abzuwenden: das Notwendige.
Die Notwendigkeit
Wie soll eine weltweite Krise bewältigt werden, wenn es keinen weltumspannenden Ansatz für eine Wende gibt?
Für das Notwendige muss zunächst einmal, wie oben beschrieben, die Not erkannt werden. Das, was die Umweltbewegungen des 20. Jahrhunderts vorbereitet haben und jetzt von NGOs, Initiativen, Aktivist:innen und Forscher:innen, Klimaschutzbündnissen und Klimaschutzministerien fortgeführt wird, benötigt das Verständnis der großen Mehrheit der Gesellschaft: Es braucht einen Wandel in unserer Lebensweise, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Eine Lebensweise, mit der wir die Vielfalt und Resilienz von Ökosystemen fördern. Im Gegensatz zu einer Lebensweise, bei welcher wir die Ressourcen von Ökosystemen für unseren individuellen Wohlstand nutzen.
Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit von Systemen gegenüber Bedrohungen sowie die Fähigkeit zur Regenerierung nach Belastungen. Der Begriff hat in den letzten Jahren in immer mehr wissenschaftlichen Disziplinen Einzug gefunden. Ich habe den Begriff der Resilienz in Bezug auf Naturkatastrophen kennengelernt. Eine Gesellschaft in einer Erdbebenregion ist resilienter, wenn die Häuser starken Erdbeben standhalten können. Wie Menschen mit persönlichen Verlusten langfristig zurechtkommen, ist eine Frage, die sich hierbei zum Beispiel die Psychologie in Hinblick auf die Resilienz stellen könnte.
Das Narrativ, welches es dafür braucht, gibt es schon: Wir Menschen sind Teil des Ökosystems, das uns umgibt − Mensch und Natur existieren nicht getrennt voneinander. Das ist die notwendige Geschichte, die erzählt werden muss, damit ein Wandel in unserer Lebensweise im Großen und Ganzen gelingen kann.
Diese Geschichte ist nicht neu. Sie wird schon seit geraumer Zeit in verschiedenen Kreisen auf verschiedene Weise erzählt. Eine der vielleicht bekanntesten davon, ist die Gaia-Hypothese. Sie wurde wie „The Limits to Growth“ 1972 von dem Chemiker James Lovelock und der Biologin Lynn Margulis formuliert. Es ist eine Geschichte, die davon erzählt, wie alles zusammenhängt, was auf diesem Planeten passiert. Eine Geschichte, die ich erst in meinem Geographie-Studium kennenlernen durfte.
Es braucht keinen „neuen“ weltumspannenden Ansatz. Es braucht eine wachsende Anzahl an Menschen, die sich mit dieser im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte weiterentwickelten Geschichte identifizieren und diese selbst weitererzählen, damit sie Stück für Stück von mehr Menschen getragen wird.

Foto: Sophie Tichonenko
Ich möchte ein kleines Beispiel geben, was ich damit meine: Immer wieder sehe ich Menschen ihre Kippenstummel wegschnippen oder auf dem Boden austreten. Auch in meinem Umfeld erlebe ich hin und wieder einen solchen Moment. Wenn ich das miterlebe, stellen sich bei mir die Haare auf. Müll einfach so in den freien Raum zu werfen, widerspricht der Geschichte, an die ich glaube. Das war nicht immer so, als Kind und Jugendlicher habe ich genauso gedankenverloren meinen Müll hinterlassen. Was hat sich verändert? Im Laufe der Zeit durfte ich lernen, wie der Abrieb von kleinen Verpackungen in Form von Mikroplastik sich überall ablagert. Heute findet sich Mikroplastik überall auf der Welt. Im Laufe der Zeit haben mir verschiedene Menschen erzählt, dass die Natur und ich Teil des gleichen übergeordneten Systems sind, und ich habe verstanden, dass mein Müll meine eigene Lebensgrundlage verschmutzt.
Wenn jemand also einen Kippenstummel wegschnippt, dann nicht, weil dieser Mensch schlecht ist. Nein, dieser Mensch lebt in einer anderen Geschichte. Wenn wir davon überzeugt sind, dass die Geschichte vom Umwelt- und Klimaschutz wichtig ist, dann müssen wir sie erzählen. Und zwar auf Augenhöhe, sodass Mitmenschen der Erzählung zuhören und sich für eine neue Geschichte öffnen können. Das Entscheidende ist: Wenn ich mich selbst als Teil von etwas wahrnehme, realisiere ich Stück für Stück, dass meine Handlungen zählen. Dass das, was ich tue, eine Relevanz und Wirkung hat. Das bedeutet, dass ich zwar nicht allmächtig bin, aber auch nicht ohnmächtig – ich bin partiell mächtig. So hat es die Psychoanalytikerin Ruth Cohn formuliert. Und genau darin liegt die Chance: Menschen erfahren, dass sie selbst wirksam sind.
Die Chance
In Krisenzeiten halten Menschen zusammen. Differenzen, die für Streitigkeiten verantwortlich waren, werden unwichtig, wenn auf einmal viel mehr auf dem Spiel steht. Dadurch wächst die Solidarität, auf welche wir alle angewiesen sind: Bin ich in einer Lebenskrise, kann ich mich auf die Unterstützung meiner persönlichen Beziehungen und auf gesellschaftliche Institutionen verlassen. Im Umkehrschluss braucht die Gesellschaft in Krisenzeiten den Einsatz möglichst vieler Einzelpersonen, damit die eben beschriebene Solidargemeinschaft nicht zerbricht, sondern fortbestehen kann.
Wenn ich eine Krise habe, brauche ich die Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft in einer Krise steckt, braucht sie die einzelnen Menschen.

Foto: Sophie Tichonenko
Diese gegenseitige Abhängigkeit von Individuum und Kollektiv gibt der Gesellschaft einen Sinn und uns Individuen eine Aufgabe. Nie spüren wir das deutlicher als inmitten einer Krise. Und in dem Sinne ist eine Krise eine Chance: Sie lässt uns spüren, dass wir nicht getrennt von unseren Mitmenschen leben können. Wir sind auf sie angewiesen und sie auf uns.
Solidarität bedeutet, sich für etwas stark zu machen und dafür einzustehen, ohne dabei selbst direkt davon zu profitieren. Allerdings unterstütze ich mit meinem solidarischen Verhalten nicht nur meine Mitmenschen, sondern auch mich selbst. Denn Solidarität ist eine Haltung der Verbundenheit. Wenn ich mich für die Gemeinschaft einsetze, mit welcher ich mich solidarisiere, dann fördere ich damit auch meine eigenen Werte, die mir wichtig sind.
Du willst mehr karla?
Werde jetzt Mitglied auf Steady und gestalte mit uns neuen Lokaljournalismus für Konstanz.

Oder unterstütze uns mit einer Spende über Paypal.![]()